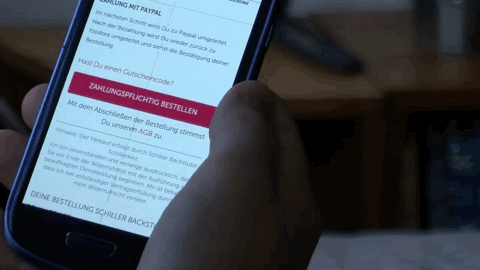Was geschieht eigentlich mit Deinen Daten, wenn Du Essen bestellst?
Ein kritischer Blick auf das Geschäft von foodora und Co.
Neue Lieferservices schießen aus dem Boden, oder vielmehr aus dem Internet: Lieferando, Deliveroo, Foodora, Pizza.de und viele mehr machen teilweise aggressiv Werbung und buhlen um einen Markt, der großes Wachstum verspricht. Etwa 20 Millionen Deutsche (über 14 Jahre) bestellen sich einmal im Monat oder häufiger eine Mahlzeit und nur etwa 25 Millionen geben an, das nie zu tun.
Wir haben mit einer Person eines bundesweiten Lieferservice in Deutschland gesprochen. Sowohl Daten wie auch das Interview bleiben auf Wunsch anonym und nicht zugänglich.
Das Konzept ist verlockend einfach: Auf der Webseite etwas auswählen, bestellen und online bezahlen und innerhalb kürzester Zeit eine Mahlzeit nach Hause geliefert bekommen. Ist das aber wirklich alles, was bei foodora und Co passiert?
Welche Prozesse laufen eigentlich im Hintergrund ab?
Über eines sind sich die Dienste mit den Investoren und Beobachtern einig:
Im Moment werfen sie noch keine Gewinne ab. Wie auch, fragt man sich, die Dienste verlangen von ihren Nutzern eine überschaubare Gebühr von normalerweise zwei bis drei Euro und eine Provision von den Restaurants (bei Zeit Online ist von immerhin 30% die Rede), das deckt zu weniger betriebsamen Tageszeiten nicht einmal den Mindestlohn, den die Fahrer gezahlt bekommen müssen.
Unklar ist, ob die Dienste darauf abzielen, langfristig eine Monopolstellung zu ergattern, um neue Einnahmequellen zu erschließen, oder aber ein so breites Publikum zu gewinnen, dass die Masse den Dienst rentabel macht.
Zwei Dinge sind aber sicher:
Erstens:
Bei einem solchen Dienst werden große Mengen an Daten über Personen (-> HIER KLICKEN) und Nutzerdaten gesammelt:
Wie heißt Du? Wo wohnst Du? Was isst Du gern, wann und wie viel davon? Isst Du oft zu Hause?
Isst Du oft allein? Ernährst Du dich gesund? Wieviel gibst Du für Essen aus?
Wie ist deine Bankverbindung? Gibst Du Trinkgeld…?.
Zweitens:
Wo Daten gesammelt und mit Algorithmen (-> HIER KLICKEN) verarbeitet werden, sind auch Datenschützer nicht weit. Wir haben mit Ben Schumacher gesprochen, er ist Informatikstudent an der Humboldt-Universität zu Berlin und Netzaktivist.
Die Datenschutzerklärungen zum Beispiel von Foodora oder Deliveroo, die in Berlin gerade marktführend sind, sind recht übersichtlich.
Doch was stutzig macht: Man muss ihnen nicht zustimmen, wenn man sich anmeldet. Ebensowenig den AGB, die bekanntermaßen kaum jemand liest…

Stattdessen akzeptiert man sie bei jeder Bestellung, die man per Klick absendet, erneut.
Wenn man hungrig ist, sich bereits etwas zu Essen ausgesucht hat und ungeduldig wird.
Das enthebt die Unternehmen auch der Last, Nutzer über Änderungen in den Bestimmungen zu informieren,
da man diese jedes Mal erneut akzeptiert.
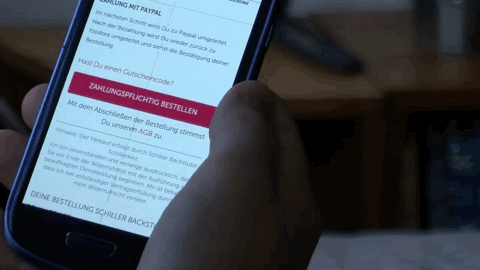
Datenschützer übernehmen heutzutage die Aufgabe von Science-Fiction-Autoren und malen uns vielfältige und meistens düstere Zukunftsvisionen aus. Welche Daten verarbeiten denn nun die Lieferdienste?
Das Statement bleibt bis auf weiteres auf Wunsch künftig anonym und nicht zugänglich.
Was ist PCI? -> HIER KLICKEN
Laut eigenen Angaben werden also kaum Nutzerangaben analysiert. Das Augenmerk liegt darauf, wie sich das Geschäftsmodell optimieren und nicht ausweiten lässt. Dennoch bleibt die Frage offen, warum überhaupt alle Bestellungen dauerhaft gespeichert werden müssen.
Ob, wie die einen befürchten das Ende der Demokratie gekommen ist, ob Krankenkassen in Zukunft anhand der Datensätze von Smartphones und Smartwatches entscheiden werden, ob jemand überhaupt noch versichert wird, oder ob wir in nächster Zukunft schon von Konzernen regiert und von Algorithmen gesteuert werden, darüber herrscht große Uneinigkeit zwischen Verschwörungstheoretikern, Datenschützern und Lobbyisten.
Viele Menschen sind der Meinung, in der Masse der Daten, die jeden Tag überall entstehen, „unterzugehen“, also unsichtbar in der Menge zu sein. Verschiedene Studien haben allerdings gezeigt, dass anonymisierte Daten, denen kein Name oder Ähnliches zugeordnet ist, sich sehr einfach wieder personenbezogen auslesen lassen. Das ist durch die schiere Menge an Datensätzen möglich, die bereits jetzt über viele Menschen existieren und die käuflich erworben werden können.
Dabei muss man kein Verschwörungstheoretiker sein, um sich zu fragen, ob es vielleicht bedenklich ist, wenn jedes Detail des eigenen Lebens mithilfe von Big Data nachvollziehbar wird.
Big Data wird bereits angewendet, dennoch ist es unsicher, ob es ein Fluch oder ein Segen für uns sein wird. Ob diejenigen Recht behalten werden, die lächelnd abwinken oder jene, die überall bösartige Interessensgruppen wähnen wird die Zukunft zeigen.